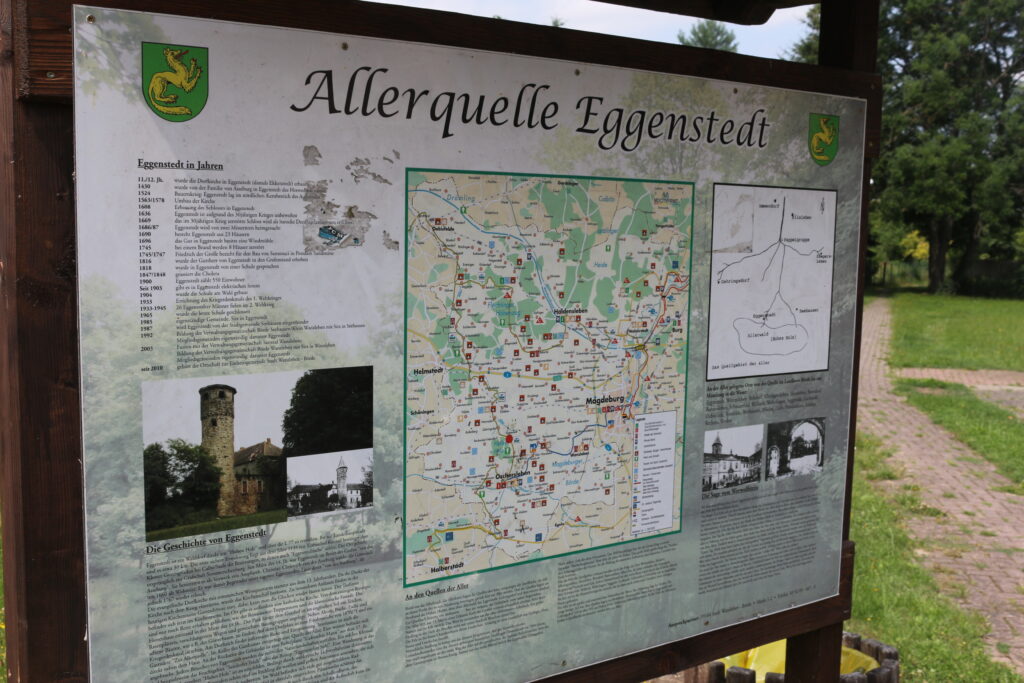Irgendwann im Frühjahr las ich einen Beitrag des ADFC über den Radweg Berlin-Hameln (RBH). Der war ziemlich neu und sollte aufs Sorgfältigste von der Ortsgruppe Hildesheim ausgearbeitet sein. Zudem wurde ein Begleitbuch angepriesen, das den Radweg ausführlich beschreiben sollte. Das hat mich natürlich sehr interessiert, nachdem ich ausführlich die Website des ADFC Hameln studiert hatte. Auf einer unserer vorherigen Radtouren haben wir bereits Hameln besucht (s. hier).
Der Radweg
An- und Abfahrt, Unterkünfte
Die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hameln ist sehr gut. Wir sind problemlos von Berlin mit dem IC nach Hannover und von dort nach Hameln mit der S-Bahn ohne Stress gefahren.
Für den Rückweg hatten wir vorgesehen, bis Potsdam (Hauptbahnhof) zu radeln und dann mit der S-Bahn nach Hause; diese Überlegung kam daher, dass die letzte Etappe über 90 km gehabt hätte. Letztendlich spielten das Wetter und unsere Kondition mit, dass wir bis vor unsere Haustür in Berlin geradelt sind.
Sechs Übernachtungen hatten wir eingeplant und auch vorher gebucht. Das ging ohne Probleme über die bekannten Internetportale.
Start in Hameln
Hameln haben wir schon einmal anlässlich der Radreise auf dem Werra-Weser-Radweg besucht. Wir buchten wieder dasselbe Hotel und sahen uns noch einmal gründlich in der Altstadt um.
Auf dem ersten Foto ist die Zentrale des ehemaligen Beamtenheimstättenwerks (BHW), ein ursprünglich als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte zum Bausparen eingerichtetes Finanzunternehmen, das günstige Konditionen für Angehörige des Öffentlichen Dienstes anbot, Nach 1990 wechselten die Besitzverhältnisse an dem Unternehmen mehrfach, heute ist das BHW eine Tochter der Deutschen Bank. Der riesige Parkplatz des imposanten Gebäudes war bei unserer Vorbeifahrt (fast) leer, sodass zu vermuten ist, dass hier keine großen Aktivitäten mehr stattfinden.
1. Etappe: Hameln-Hildesheim
Am nächsten Tag brechen wir bei noch erträglichen Radel-Temperaturen auf. Der Himmel ist bedeckt, es gibt am Rande der Strecke kaum etwas Interessantes außer Landwirtschaft zu sehen, weil wir durch die Zuckerrübengegend fahren. Ringsum flaches Land. Unterwegs passieren wir zunächst Coppenbrügge. Leider ist hier das Schlossmuseum aufgrund der Pandemie-Maßnahmen geschlossen und wir müssen uns mit einer Außenbesichtigung zufrieden geben. Das Schloss Marienburg, das sich einst im Besitz des „Skandalprinzen“ Ernst August Erbprinz von Hannover befand und später in eine Stiftung überführt wurde., liegt auf unserer Route. Vor ca. 25 Jahren haben wir einmal die Marienburg mit unseren Kindern besichtigt.
Hildesheim ist eine autogerechte Stadt: für Radfahrer gibt es hier wenig Raum. Wir erkunden trotzdem die historische Innenstadt,
Neben den vielen schönen Fachwerkhäusern in der Innenstadt besichtigen wir den interessanten Dom mit seinem tausenjährigen Rosenstock.
2. Etappe: Hildesheim-Wolfenbüttel
Wieder beginnt ein Tag mit nicht allzu einladendem Wetter, wir arbeiten uns durch den morgendlichen Autoverkehr aus Hildesheim heraus, um uns herum braust der Autoverkehr…
Nach ein paar Kilometern weiter können wir endlich entspannt radeln. Wir finden in Ottbergen die Dependance eines Franziskanerklosters mit Wallfahrtskirche. Da wir heute nicht so viele Kilometer fahren müssen, schauen wir uns hier gründlich um.
In der Nachfolge gelangen wir in den Umkreis der Stadt Salzgitter, einer Industriestadt par excellance. Der RBH wird jedoch so geführt, dass wir kaum etwas davon bemerken – weder Stadt noch Industrie begegnen uns wirklich auf unserer heutigen Etappe.
Kurz vor unserem Salzgitter fahren wir noch am Salzgittersee – dem Naherholungsgebiet der Region – vorbei. Wir sind erstaunt, wie schön so ein See nicht weit von einer Industriestadt sein kann. In einem Stadtteil von Salzgitter liegt das Schloss Salder, das wir unter strengen Hygienemaßnahmen besichtigen.
Schließlich gelangen wir nach Wolfenbüttel, unserem heutigen Etappenziel.
Da es mittlerweile schon Nachmittag ist, hat kein Museum mehr auf. Wir begnügen uns mit einer Außenansicht des Schlosses und der berühmten Bibliothek. Die Statue von Wilhelm Busch in der Innenstadt erscheint uns gut gemeint, aber – na, na…
3.Etappe: Wolfenbüttel-Schöningen
Die dritte Etappe führt uns bei trübem Himmel wieder über flaches Land. Unterwegs sehen wir ein altes Gebäude einer Zuckerrüben-Verarbeitungsfabrik, das außergewöhnlich in der Landschaft steht.
Wir landen in Schöppingen, der Eulenspiegel-Stadt. Das Till-Eulenspiegel-Museum haben wir schon vor Jahrzehnten einmal besucht (wo wir die einzigen Gäste waren). Im Garten des Museums sehen wir eine Statue der Sagenfigur.
In Jerxheim, das wir bald erreichen, sehen wir einen Hinweis zum Bismarckturm. Da wir „Experten“ für „Bismarcktürme“ aller Art sind, ist dieser auch gkeich im Zentrum unseres Interesses. Wir nehmen einen deutlichen Umweg in Kauf und besteigen (Fahrrad schieben) die Anhöhe zu Turm. Wegen des bescheidenen Wetters hat man keine gute Sicht von der Turmspitze.
Am Rande von Schöningen besuchen wir noch die Kirche St. Lorenz mit ihrem wunderschönen Bibelgarten bevor wir uns in unser Hotel begeben.
Schöningen liegt ja am Rande des Elm und war in der Vorwendezeit „Naherholungsgebiet“ der Berliner; von daher ist uns die Gegend recht vertraut. Allerdings haben wir die Stadt seit der Öffnung der Grenzen nicht mehr besucht, und seitdem hat sich hier eine Menge – wie auch in den anderen kleinen Städten der Region – eine Menge verändert: Vieles wurde modernisiert, manches neu gebaut – nicht immer zum Vorteil für die Bewohner und Besucher.
4. Etappe: Schöningen – Schönebeck (Elbe)
Unser Hotelwirt hat uns mit Informationsmaterial über die Region überschüttet und uns auch noch vor unserer Abfahrt wiederholt daran erinnert, nicht zu vergessen in das Forschungsmuseum Schöningen „Paläon“ zu gehen. Das haben wir auch dann als erstes an diesem Tag gemacht und waren sehr beeindruckt. Das Museum liegt direkt am ehemaligen Braunkohletagebau, der – inzwischen stillgelegt – Braunkohle für das nahegelegene Kraftwerk Buschhaus geliefert hat. Das Kraftwerk wurde 1985 in Betrieb genommen und stand von Anfang an unter der Kritik, die Umwelt nachhaltig zu verschmutzen; aufgrund der vorherrschenden Westwinde war selbst Berlin von den Abgasen des Kraftwerks betroffen. Es wurde später vorzeitig vom Netz genommen.
Gleich hinter der tiefen, beeindruckenden Kohlegrube von Schöningen erreichen wir den ehemaligen Grenzort Hötensleben, in dem ein Grenzmuseum eingerichtet ist. Im Unterschied zu den vielen Grenzmuseen, die ich bisher gesehen habe, zeichnet sich dieses dadurch, dass man auch die Flächenausdehnung der Grenzanlagen mehr erfahren kann.
Danach kommt nur noch – wie der Berliner sagt: „Nüscht“. Wir fahren durch die Magdeburger Börde, die Sonne scheint, ringsum um uns nur üppige Felder und weite Sicht. Wieder einmal die Gelegenheit, wo Radfahren zur Meditation wird.
Bevor wir unser heutiges Etappenziel erreichen durchfahren wir Bad Salzelmen, den Vorort von Schönebeck. Wir bewundern den schön angelegten Kurpark und schieben unsere Fahrräder tief atmend am Gradierwerk mit seiner herrlich salzhaltigen Luft vorbei. Sehr gesund für die Atemwege! 😉
Das Hotel in Schöningen sieht von außen nach nichts aus, ist aber innen sehr gepflegt und gut ausgestattet. Wir suchen uns ein nettes (jugoslawisches) Restaurant in der Innenstadt und erkunden danach die Stadt und vor allen das Elbufer.
5. Etappe: Schönebeck (Elbe)-Gräben
Der nächste Tag beginnt mit ein wenig Orientierungslosigkeit. Unser Navi zeigt zwar konstant die Richtung an, alle Wegweiser stimmen, aber gefühlt fahren wir falsch. Das ist aber nicht so. Es kommt uns nur so vor, weil wir auf unserem Weg nach Osten auch entlang eines Altarms der Elbe radeln.
Recht rasch gelangen wir nach Gommern und nähern uns nun der südwestlichen Grenze zum Fläming. Unser erster Eindruck wird durch den kleinen See Kulk bestimmt, an dessen Westufer sich die Wanderdüne am Fuchsberg befindet. Auf der Ostseite des Kulk hat die Stadt einen interessanten Gesteinsgarten eingerichtet.
Wir werfen anschließend einen Blick in die Innenhöfe der Wasserburg Gommern, die heute ein Hotel beherbergt: Nobel…
Bei strahlendem Sonnenschein und steigenden Temperaturen fahren wir weiter nach Leitzkau. Schon aus der Ferne sehen wir in dem sehr ebenen Gelände die Silhouette des herrlichen Schlosses.
Leider können wir Schloss Leitzkau nicht besichtigen, aufgrund der Corona-Krise sind die Besichtigungstouren auf ein Mindestmaß herunter gefahren. Wir sehen uns gründlich im Innenhof und im Garten des Schlosses um und naschen noch ein paar von den herrlich reifen Kirschen, die uns von einem Kirschbaum vor der Nase hängen.
Der Rest des Weges bis in den Fläming nach Gräben ist relativ unspektakulär. Wir fahren ein ganzes Stück auf einem Bahnradweg, der augenscheinlich von vielen älteren E-Bikern benutzt wird. Die Steigungen, Gefälle und Kurven halten sich in Grenzen und wir erreichen bald unser heutiges Etappenziel Gräben.
Das Dorf Gräben liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Fluss Verlorenwasser; der Name es Flusses ist Programm für das Dorf: Hier ist absolut nichts los! Kein Geschäft – nichts. Außerdem ist Sonntag… Aber unser sehr kommunikativer Pensionswirt ist mit etlichen Bieren im Kühlschrank eine hilfreiche Stütze. Die Umgebung des Dorfes ist übrigens außerordentlich idyllisch, wie wir bei einem spätabendlichen Spaziergang feststellen.
6. Etappe: Gräben-Berlin
Nach einem außerordentlich üppigen Frühstück, das uns bei herrlichstem Wetter im Garten serviert wird, brechen wir auf in Richtung Heimat.
Die Wettervorhersage ist nicht so berauschend für diesen Tag, sodass wir beschließen, bis Potsdam zu radeln und dann mit dem ÖPNV nach Hause zu fahren. Es ist schon am Vormittag in der Wettervorschau zu sehen, dass es bis am frühen Nachmittag schön sonnig und warm, danach aber unbeständig mit Schauern und Gewittern werden kann.
Märkische Heide, märkischer Sand“ sind jetzt unsere steten Begleiter. Einen ersten Stop machen wir beim Kloster Lehnin. Bedingt durch Corona gibt es zurzeit keine Besichtigungstouren – zumindest, wenn man – wie wir – nicht angemeldet ist.
Im Ort selbst versorgen wir uns – heute am Sonntag – mit frischen Brötchen, weil wir nicht vorhaben, an unserem letzten Tag noch einmal essen zu gehen.
Der Rest der Tour ist relativ unspektakulär: Wir stellen durch einfache Himmelbeobachtung fest, dass die Schlechtwetterlage am Nachmittag ausbleiben könnte und beschließen, von Potsdam bis nach Hauee zu radeln.
Das Wetter bleibt auch stabil. Wir rasten kurz in Babelsberg, wo wir ein schönes italienisches Eis essen, und radeln ganz entspannt nach Hause.
Qualität der Radwege
Verglichen mit den bisherigen Erfahrungen, die wir bei Radwanderungen gemacht haben, kann das Urteil über die Qualität der Radwege und deren Auszeichnung leider nicht allzu positiv ausfallen. Man muss allerdings nach den landschaftlichen Eigenschaften auch Unterschiede in der Bewertung machen.
Wir haben die Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin durchquert. Vorbildlich bei der Markierung der Radrouten sind insgesamt Brandenburg und Berlin. In Niedersachsen sind einige Kommunen sehr fortgeschritten in der Markierung ihrer Radrouten, in Sachsen-Anhalt muss man oft raten, wie es weiter geht.
Wichtig für die Qualitätsbeurteilung eines Radwegs ist auch die Güte der Oberfläche. Hier mussten wir feststellen, dass in allen Bundesländern relativ viele (ca. 30%) der Wege mit Schotteroberflächen versehen waren – Sachsen-Anhalt stach hier besonders negativ hervor.
Der Erlebniswert des Radwegs fällt durchgehend positiv aus. Es gibt viel Kultur im Bereich des Radwegs zu entdecken. Für uns war die Tour auch ein Trip durch unsere Vergangenheit im kalten Krieg, wo die damalige DDR für uns nicht existent war. Zum Glück haben sich inzwischen viele darum gekümmert, Kultur für die Nachwelt zu erhalten.
Fazit
Wir benoten die einzelnen Kategorien mit Schulnoten (1 = Beste – 6 & Schlechteste)
- Erlebniswert
1 - Wegführung
2 - Wegbeschaffenheit
4 - Dokumentation
1